18
2016Erstmals konnten Astronomen beobachten, wie die nahegelegene Spiralgalaxie Messier 81 einen sehr hellen Ausbruch im Bereich der Radiowellen durchlief. Der Ausbruch ereignete sich im Jahr 2011 und wurde über mehrere Wochen hinweg in unterschiedlichen Wellenlängen untersucht
 von Tilmann Althaus Die Spiralgalaxien Messier 81 und Messier 82 im Sternbild Großer Bär (Übersichtsaufnahme)
von Tilmann Althaus Die Spiralgalaxien Messier 81 und Messier 82 im Sternbild Großer Bär (Übersichtsaufnahme)
Die Spiralgalaxie Messier 81 im Sternbild Großer Bär ist mit einer Entfernung von rund zwölf Millionen Lichtjahren eine der uns nächsten aktiven Galaxien. Sie beherbergt in ihrem Zentrum ein massereiches Schwarzes Loch mit dem 70-Millionenfachen einer Sonnenmasse. Das Schwarze Loch ist von einer rotierenden Akkretionsscheibe aus Gas und Staub umgeben, von der zwei Gasstrahlen (Jets) in Richtung der Rotationspole der Scheibe ausgehen. Nun konnten Forscher um Ashley L. King an der kalifornischen Stanford University bei M 81 erstmals einen Ausbruch im Bereich der Radiowellen beobachten. Er ereignete sich im Jahr 2011 und weckte das Interesse der Astronomen. Sie sorgten dafür, dass in der Folge die Galaxie und ihr aktiver Kern in unterschiedlichen Wellenlängen beobachtet wurde. Unter anderem wurden der Röntgensatellit Swift und das Very Long Baseline Array (VLBA), ein weltweiter Verbund von Radioteleskopen, für die Beobachtungen der Galaxie eingesetzt.
http://www.spektrum.de/news/ein-ausbruch-in-der-spiralgalaxie-messier-81/1407619
16
2016
Das Puzzle der kosmischen Chemie in interstellaren Wolken.
Eine ungelöste Frage ist die Bildung organischer Verbindungen in interstellaren Wolken. Diese komplexe Chemie basiert auf Ionen und Radikalen, die in Stößen mit Photonen und kalten Elektronen entstehen. Dabei spielt das H3+-Molekül eine Schlüsselrolle. Der Aufbruch von Molekülen nach Einfang eines Elektrons („dissoziative Rekombination“) kann in Speicherringen gezielt untersucht werden. Mit dem neuen kryogenen Speicherring CSR werden erstmals Bedinungen erreicht, die interstellaren Temperaturen entsprechen und auch die Rotation von Molekülionen quasi „einfrieren“ lassen. Erste Studien bei Temperaturen unter 15 K konnten bereits mit dem CSR-Prototyp, der linearen Ionenfalle CTF, durchgeführt werden. Von besonderem Interesse sind hier negative Molekülionen (Anionen), die eine wichtige Quelle langsamer Elektronen darstellen, indem sie bei entsprechender innerer Anregung (Schwingung) Elektronen regelrecht „abdampfen“ können. Kollisionen mit neutralen Atomen und Molekülen sind gleichfalls von großer Bedeutung für die Astrochemie. Eine Kollisionsstrecke für Neutralstrahlen im CSR erschließt dieses experimentell noch weitgehend unerforschte Gebiet.
13
2016VLT Survey Telescope gelingt Aufnahme des Fornax-Galaxienhaufens

Dieses neue Bild des VLT Survey Telescope (VST) am Paranal-Observatorium der ESO in Chile zeigt eine beeindruckende Anhäufung von Galaxien, die als Fornax-Galaxienhaufen bezeichnet wird und sich im Sternbild Chemischer Ofen (lat. Fornax) in der südlichen Hemisphäre befindet. Der Galaxienhaufen beheimatet eine Menagerie aus Galaxien aller Arten und Größen, von denen manche Geheimnisse zu verbergen haben. Galaxien sind wie es scheint kontaktfreudige Wesen die sich gerne in großen Gruppen versammeln, sogenannten Galaxienhaufen. Tatsächlich ist es die Gravitation, deren Anziehungskraft durch die großen Mengen Dunkler Materie und sichtbaren Galaxien entsteht, die sie in dem Haufen als Einheit eng zusammenhält. Solche Galaxienhaufen können zwischen etwa 100 und 1000 Galaxien enthalten und sich über etwa 5 bis 30 Millionen Lichtjahre erstrecken.
07
2016NGC 1600 beherbergt schwarzes Loch mit 17 Milliarden Sonnenmassen.

Extrem massereiche schwarze Löcher können nicht nur in großen Galaxienhaufen wachsen, wie jetzt die Entdeckung in einer Galaxie nicht allzu weit entfernt von unserer Milchstraße zeigt. Ein internationales Astronomenteam analysierte Daten aus einer Beobachtungkampagne zu massereichen Galaxien. Dabei fanden sie im Innern der Gruppengalaxie NGC 1600 ein schwarzes Loch mit 17 Milliarden Sonnenmassen – eines der massereichsten schwarzen Löcher, das bis heute gefunden wurde.
06
2016Wissenschaftler erforschen, wann Supernovae in der Nähe der Erde explodierten

Eine unter Astrophysikern lange ungeklärte Frage ist gelöst: Wann und wo sind Sterne in jüngster Vergangenheit in der Nähe des Sonnensystems explodiert? Ein Forscherteam vom Zentrum für Astronomie und Astrophysik der TU Berlin konnte in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern vom Zentrum für Astronomie der Universität Heidelberg und dem Department of Mathematics der Universität Evora mit Hilfe ausgefeilter Modellrechnungen zeigen, dass in den vergangenen 13 Millionen Jahren 16 solcher sogenannter Supernovae nahe der Erde stattfanden. Die Forscher unter Leitung von Prof. Dr. Dieter Breitschwerdt (TU Berlin) nutzten für ihre Untersuchungen 60Fe, ein radioaktives Eisenisotop, das nur in Riesensternen und Supernovae fusioniert wird. Das Isotop diente als Indikator für die Entfernung und den Zeitpunkt der Explosionen. Diese Ergebnisse sind jetzt in einem Letter in der Ausgabe vom 7. April 2016 des Fachjournals Nature erschienen, zusammen mit einem weiteren Artikel einer zweiten internationalen Forschergruppe der Australian National University, unter Federführung von Dr. Anton Wallner, die genaue Messungen von 60Fe an mehreren Proben im Ozeanboden vorgenommen hat.
06
2016Ein supermassereiches Schwarzes Loch in einer eher durchschnittlichen Galaxie überrascht Astronomen. Müssen ihre Modelle wieder einmal überarbeitet werden? von Daniel Lingenhöhl

Eines der massereichsten Schwarzen Löcher sitzt in einer Galaxie, die eigentlich gar nicht dafür ausgelegt ist – zumindest nicht nach den gängigen Modellen der Astronomen. Dieser Behemoth, wie ihn die NASA auf ihrer Webseite nennt, befindet sich wohl im Zentrum der Galaxie NGC 1600 und weist 17 Milliarden Sonnenmassen auf, was das Schwarze Loch zum zweitgrößten nach dem Schwerkraftmonster im Zentrum des Coma-Galaxienhaufens macht. Das berichten Astrophysiker um Jens Thomas vom Max-Planck-Institut für Extraterrestrische Physik in Garching in „Nature“. Die Wissenschaftler waren von der Größe des Schwarzen Lochs ziemlich überrascht, denn NGC 1600 – 200 Millionen Lichtjahre von uns entfernt im Sternbild Eridanus gelegen – zählt nur zu einer durchschnittlich großen Galaxie, während die supermassereichen Giganten bislang lediglich in sehr aktiven und dichten Sternhaufen ausgemacht wurden.
http://www.spektrum.de/news/behemoth-ein-unerwartetes-schwarzes-loch/1406675
06
2016Für die nächsten drei Wochen lässt sich Merkur leicht am Abendhimmel auffinden, denn der sonnennächste Planet erreicht im April einen geeigneten Abstand zur Sonne. Der Planet zeigt sich tief am westlichen Horizont.

Ein seltener Gast am Himmel lässt sich im April für die nächsten drei Wochen gut beobachten: Der sonnennächste Planet Merkur zeigt sich am Abendhimmel tief am westlichen Horizont. Er erreicht am 18. April seine größte östliche Elongation zur Sonne, das heißt, er eilt dem Tagesgestirn am Himmel hinterher. Dank der steilstehenden Ekliptik, der Hauptebene des Sonnensystems, in der alle acht Planeten umlaufen, ergibt sich damit die beste Abendsichtbarkeit des Jahres: Fast den ganzen Monat lang kann der innerste Planet gesichtet werden.
01
2016Hinweise auf Planetenentstehung bei erdähnlichem Abstand von einem jungen Stern

Diese neue Aufnahme vom Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) zeigt die bislang feinsten Details einer protoplanetaren Scheibe um den nahegelegenen sonnenähnlichen Stern TW Hydrae. Das Bild zeigt eine faszinierende Lücke in dem Abstand vom Stern, in dem sich in unserem Sonnensystem die Erdumlaufbahn befindet. Das könnte bedeuten, dass sich dort gerade eine jüngere Version unseres Heimatplaneten oder eine etwas massereichere Supererde dort bildet.
Der Stern TW Hydrae ist aufgrund seiner Nähe zur Erde – er ist nur etwa 175 Lichtjahre entfernt – und seines Status als junger Stern von etwa 10 Millionen Jahren unter Astronomen ein beliebtes Studienobjekt. Wir schauen zudem direkt von oben auf die protoplanetare Scheibe, die den Stern umgibt. Das ermöglicht einen unverzerrten Blick auf alles, was dort vorgeht. „Vorangegangene Studien mit Radioteleskopen und Teleskopen für das sichtbare Licht hatten bereits bestätigt, dass TW Hydrae von einer deutlich sichtbaren Scheibe umgeben ist, deren Struktur stark darauf hindeutet, dass sich darin in diesem Moment Planeten anfangen zu bilden“, erläutert Sean Andrews vom Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics in Cambridge (Massachusetts) in den USA, der Erstautor der Studie, die heute in der Fachzeitschrift Astrophysical Journal Letters erscheint. „Die neuen ALMA-Daten zeigen die Scheibe mit einer unvergleichlichen Detailschärfe und lassen einen Satz heller, konzentrischer Staubringe mit dunklen Lücken dazwischen erkennen. Und es gibt faszinierende Anzeichen dafür, dass ein Planet mit einer erdähnlichen Umlaufbahn dort im Entstehen begriffen ist.“
02
2016Noch ist es nicht offiziell, aber in dieser Woche dürfte die Mission der Landesonde Philae auf dem Kometen 67P/Tschurjumow-Gerasimenko für beendet erklärt werden. Zuletzt bestand am 9. Juli 2015 für wenige Minuten Funkkontakt. von Tilmann Althaus
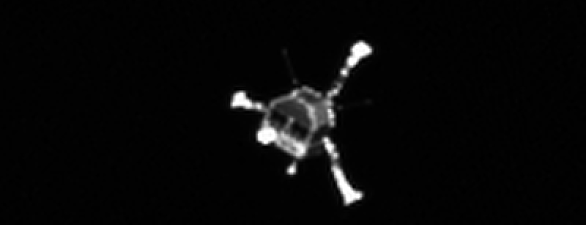
Nach vielen Monaten vergeblicher Versuche, mit der Landesonde Philae auf der Oberfläche des Kometen 67P/Tschurjumow-Gerasimenko Kontakt aufzunehmen, ist nun die Mission des Landers beendet. Auch im Januar 2016 gelang es nicht, via Muttersonde Rosetta in Kontakt mit Philae zu treten. Nun hat sich der Komet 67P so weit von der Sonne entfernt, dass die am Landeplatz eintreffende Sonnenstrahlung nicht mehr ausreicht, die Batterien von Philae für einen Betrieb aufzuladen. Zuletzt war es am 9. Juli 2015 gelungen, mit Philae für wenige Minuten in Kontakt zu treten; seitdem war nichts mehr zu hören gewesen.
http://www.spektrum.de/news/mission-des-kometenlander-philae-ist-wohl-zu-ende/1397690
02
2016
Es gibt allerlei verschiedene Karten: solche, die geologische Formationen oder die Topografie wiedergeben, andere, die politische Grenzen zeigen und noch andere, die die Wetterlage bestimmen oder die Konstellation von Sternen und Planeten darstellen. Eine Sternenkarte haben jüngst auch die Astronomen vom Heidelberger Max-Planck-Institut für Astronomie erstellt. Ihre Karte zeigt die Milchstraße, allerdings unter einem ganz bestimmten Aspekt, den Forscher bislang nicht kartiert haben: die Altersstruktur. Die beiden Astronomen Melissa Ness und Marie Martig ermittelten dafür das Alter von fast 100.000 Roten Riesensternen, die in Abständen von bis zu 50.000 Lichtjahren vom galaktischen Zentrum entfernt liegen. Die Daten für die Karte lieferten Teleskope unter anderem das NASA-Weltraumteleskop Kepler. Was ließ sich auf der Karte erkennen: Die unterschiedlichen Farben der Pixel stehen für die unterschiedlichen Sternenalter. Rot sind ältesten Sterne eingefärbt, grün Sterne mittleren Alters und blau die jüngsten Sterne. Das Farbmuster bestätigte nun, was Forscher bisher nur angenommen haben – dass die Milchstraße von innen nach außen gewachsen ist und die ältesten Sterne im Zentrum, die jüngsten in den Außenregionen liegen. Foto: M. Ness, G. Stinson/MPIA © wissenschaft.de – Ruth Rehbock/Karin Schlott
